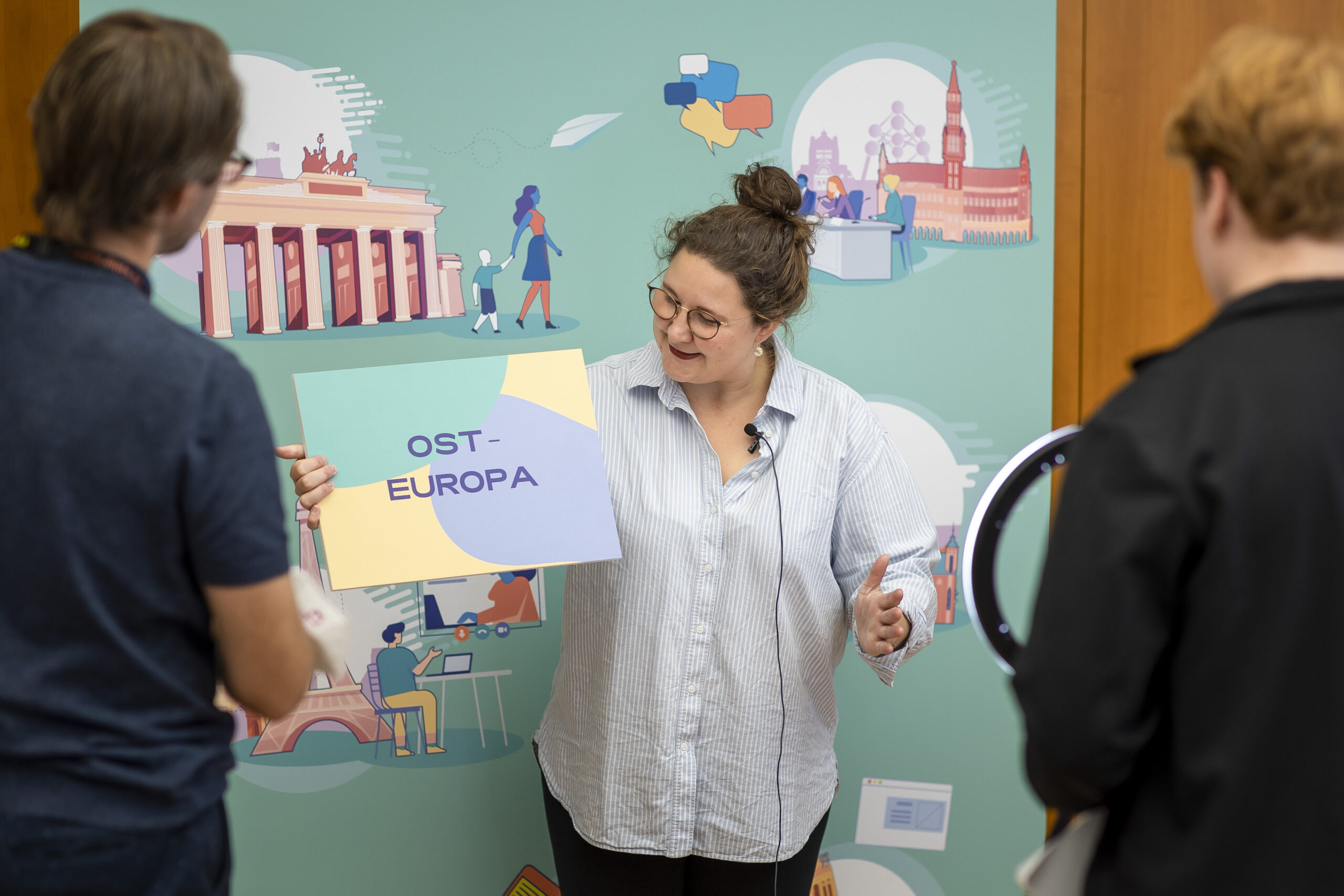Die polnische Ratspräsidentschaft in der EU (Wolfgang Merz)

Dr. Wolfgang Merz analysiert Polens EU-Ratspräsidentschaft unter Donald Tusk. Prioritäten: Sicherheit, Verteidigung, EU-Erweiterung. Schwächen: mangelnde institutionelle Reformen, Finanzierungsfragen. Fokus auf Kooperation, aber geopolitische Risiken bestehen.
Die polnische Ratspräsidentschaft in der EU
Prioritäten und Risiken
Dr. Wolfgang Merz
Nach einer eher inhaltlich dünnen ungarischen EU-Ratspräsidentschaft lautet das Motto der polnischen Präsidentschaft unter Ministerpräsident Donald Tusk „Sicherheit, Europa!“ Auch diese Präsidentschaft steht seit dem 1. Januar 2025 inmitten geopolitischer Krisen, großer wirtschaftlicher Unsicherheit und eines in Stocken geratenen europäischen Integrationsprozesses. Dies betrifft insbesondere den Finanzmarkt, die Telekommunikation, den Bankensektor und auch den Energiebereich, den Polen besonders hervorheben möchte. Den Schwerpunkt für Tusk bildet jedoch angesichts des russischen Überfall auf die Ukraine die europäische Verteidigung zu stärken (auch unter Einbeziehung von Großbritannien), die Rüstungsproduktion wieder hochzufahren und die Unterstützung für die Ukraine langfristig zu sichern. Zur Finanzierung dieser Ausgaben schlägt er eine gemeinsame europäische Aufnahme öffentlicher Schulden vor, ohne sich jedoch auf eine genaue Zahl festzulegen. Man will nicht bis zum nächsten EU-Haushalt warten, zumal von der Europäischen Kommission im 1. Halbjahr 2025 noch kein Vorschlag dazu vorliegen dürfte.
Premier Tusk definiert dabei das Sicherheit Konzept eher breit: Er will die Außengrenzen der EU stärken und die illegale Migration einschränken. Die EU soll überzeugt werden, die Grenz- und Verteidigungsanlagen an der Grenze zu Russland und Belarus mitzufinanzieren. In der Ostsee setzt sich Tusk für gemeinsame Luft- und See-Patrouillen der Nato-Staaten ein, um den russischen Sabotageakten entgegenzuwirken. Tusk möchte auch, dass Europa besser gewappnet gegenüber einer hybriden Kriegsführung durch Russland, dies gilt insbesondere für die Datensicherheit.
Polen will sich auch für Reformen einsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem Weltmarkt zu gewährleisten.
In der Klimapolitik stünde auf der Agenda, dass im Februar die EU ihr Klimaziel für 2035 an die UN liefern müsste. Dies wird jedoch kaum zu schaffen sein, weil eine Einigung unter den Mitgliedstaaten in weiter Ferne liegt und die polnische Präsidentschaft einer Neuverhandlung dieses Ziel nicht unbedingt die höchste Priorität einräumt.
Bei der EU-Erweiterung will die polnische Präsidentschaft einen Ansatz vertreten, der sich auf konkrete Fortschritte der Beitrittskandidaten bezieht. Die Ukraine kann mit der Eröffnung erster Verhandlungskapitel rechnen, auch bei Serbien und Montenegro werden Fortschritte erwartet. Die dafür notwendigen EU-Reformen werden nicht so stark gesichtet, da Polen die EU für ausreichend flexibel für die Aufnahme neuer Mitglieder sieht. Daher ist ein erster EU-Reform-Bericht erst für Juni geplant.
In der Handelspolitik ist keine große Bewegung zu erwarten, da Polen das von von der Leyen ausgehandelte Mercosur-Paket weiterhin ablehnt.
Einschätzung
Nach der reinen „Überlebensstrategie“ der Ungarn verfolgt Polen eine politische Offensivstrategie. Trumpfkarte dabei ist der Premier Tusk selbst, der als früherer Präsident des Europäischen Rates über eine enorme EU-Erfahrung verfügt sowie auch mit Polen ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Land regiert, das auch seinen militärischen Verpflichtungen überdurchschnittlich nachzukommen weiß. Allerdings ist eine Präsidentschaft kein Diktat, die anderen Mitgliedstaaten müssen in Kooperation mit der Europäischen Kommission stets für Dinge gewonnen werden.
Bemerkenswert ist auch, dass sich EU-Prioritäten weiter verschoben haben. War vor fünf Jahren das Klima ganz vorne, steht es nun nach der Sicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit erst an dritter Stelle. In dieses Bild passt, dass wichtige künftige Meilensteine der europäischen Klimapolitik wie das EU-Klimaziel 2040 unter Umständen verschleppt werden. Damit hinkt Europa auch beim G20-Zeitplan hinterher, da Brasilien, Großbritannien, Kanada und sogar die USA ihr Klimaziel 2035 bereits verkündet haben. China wäre auch bereit dazu, wartet aber erst die EU-Verständigung ab.
Das polnische Sicherheits- und Verteidigungspaket ist umfassend und ambitioniert, allerdings müsste es stellenweise durch konkrete Pläne oder Initiativen unterlegt werden. Heikel bleibt
auch die Frage der Verteidigungsfinanzierung, da sich bei einer EU-Verschuldung der Disput zwischen Nord- und Südeuropa fortsetzen dürfte. Daher dürften zunächst Fragen der Rüstungskooperation im Vordergrund stehen, bevor man sich auf konkrete Zahlen verständigt.
Nicht kalkulierbar bleiben mögliche Querschüsse des erneut gewählten US-Präsidenten Trump. Sein ersten außenpolitischen Akzente (5% des BIP für die jeweilige nationale Verteidigung; Einflussnahme auf Grönland, Panama und Kanada) steigern vorhandene Befürchtungen. Das Zollthema steht dabei noch aus. Auch besteht das Risiko, dass er mit Putin ein Abkommen zur Ukraine schmiedet, der zu Lasten der Ukraine und Europas geht. Die polnische Präsidentschaft muss dann alles darauf setzen, die Geschlossenheit der EU zu gewährleisten; Alleingänge und ein auseinander dividieren der EU gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Eine erste Blaupause dafür ist die Übertragung des fehlenden Faktenchecks bei der Plattform X auf die Plattformen des Imperiums von Zuckerberg. Die Art und Weise, wie Europa hierauf reagiert, ist sicherlich ein Präjudiz für weitere Dossiers.
Bei der EU-Erweiterung scheut die polnische Präsidentschaft anders als bei der europäischen Finanzpolitik eineinstitutionelle Reformdebatte, was viel zu kurz greift.
Auch der Trend nach ganz rechts in der westlichen Welt mit stark anti-europäischen Elementen hält unvermindert an. Kickl wird nun wohl doch in Österreich an die Macht kommen, der liberale kanadische Premier Trudeau zieht sich resigniert zurück. Weiterhin fehlt es einzelnen Mitgliedstaaten der EU sowie der EU selbst an einem Rezept, diesen Trend zu stoppen. Verbote, „Brandmauern“ und das Versäumnis, die Vorteile Europas klarer zu kommunizieren oder die oft fehlenden Alternativen der ganz rechten Strömungen mit Argumenten zu untermauern, haben kaum eine Änderung herbeigeführt. Selbst im Europäischen Parlament ist die „Brandmauer“ bereits brüchig geworden. Ob Tusk hier sonderlich aktiv werden wird, ist fraglich. Seine Spielräume hierfür sind angesichts der Präsidentschaftswahlen in Polen und einer gewissen Rücksichtnahme gegenüber der oppositionellen rechtsnationalen PIS-Partei durchaus eingeschränkt.
//
Der Autor Dr. Wolfgang Merz ist Berater, Dozent und Autor mit umfassender Erfahrung in nationalen, europäischen und internationalen Prozessen. Als ehemaliger leitender Mitarbeiter im Bundesministerium der Finanzen und Economist beim Internationalen Währungsfonds bietet er strategische Beratung, praxisnahe Bildung und fundierte Publikationen an. Sein Fokus liegt auf der Verbindung von Ökonomie und Politik, um Organisationen und Individuen in einer vernetzten Welt zu unterstützen.
Mehr unter www.wolfgang-merz.de. | contact@wolfgang-merz.de
//
Die Rubrik EAB Impulse bietet Meinungen und Analysen zu aktuellen Entwicklungen in Europa. Die Beiträge spiegeln allein die Perspektiven der Autorinnen und Autoren wider und laden zum Nachdenken und Diskutieren ein. Weitere Informationen zur Arbeit der Europäischen Akademie Berlin und zu ihren Angeboten finden Sie unter:
Homepage: www.eab-berlin.eu | Newsletter: www.eab-berlin.eu/newsletter