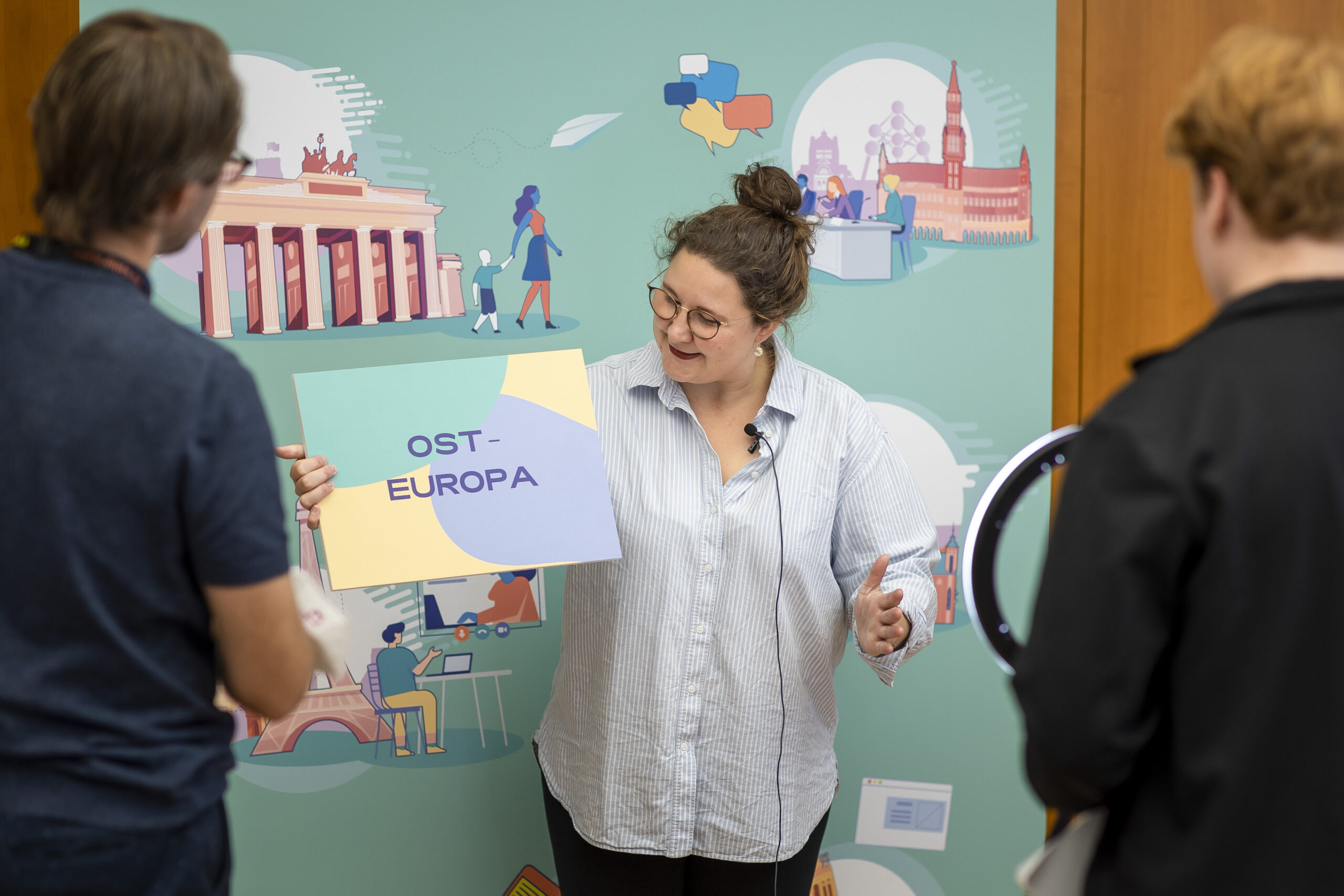Ein strategischer Kompass für die EU – Der Weg zur sicherheitspolitischen Autonomie Europas

Wie realistisch ist die Vision einer gemeinsamen europäischen Armee – und was bedeutet strategische Autonomie für die EU? Der Artikel beleuchtet sicherheitspolitische Herausforderungen, wachsende Verteidigungsausgaben und die Rolle europäischer Werte in einer zunehmend instabilen Welt.
Dieser Artikel wurde von Gonzalo Galván, Kaia Nisser und Till Stange im Rahmen des Projekts Newsroom Europe verfasst. Die Autor:innen setzen sich im Rahmen dieses Projekts mit aktuellen europäischen Themen auseinander. In trinationale Redaktionsteams eingebunden, berichten sie kritisch und konstruktiv über politische Entwicklungen und europäische Entscheidungsprozesse.
Lange erwartet: ein Plan der EU zur strategischen Autonomie. Mit dem „Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung“ möchte die Europäische Union ihre sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit stärken und unabhängiger von internationalen Partnern werden. Ein zentrales Vorhaben dabei ist die Einrichtung einer „EU Rapid Deployment Capacity“, die mit 5.000 Soldat:innen in Krisensituationen flexibel und schnell eingreifen können soll.
Doch wie realistisch ist die Vision einer europäischen Armee? Und wie stark ist die politische und gesellschaftliche Unterstützung in den Mitgliedstaaten? Der Artikel beleuchtet die Entwicklungen im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich seit dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan 2021 – einem Ereignis, das die Schwächen europäischer Autonomie in Krisensituationen schonungslos offenlegte. Die Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben diese Debatte zusätzlich beschleunigt: Die EU sieht sich gezwungen, neue Wege zur Verteidigung ihrer Interessen und Werte zu finden.
Gleichzeitig ist der Aufbau einer eigenständigen militärischen Kapazität ein hochkomplexes Unterfangen. Unterschiedliche strategische Kulturen, historische Erfahrungen und sicherheitspolitische Prioritäten innerhalb der EU machen eine gemeinsame Linie schwierig. Zudem sind nicht alle EU-Staaten Mitglied der NATO, was die Suche nach einem einheitlichen Ansatz weiter erschwert. Der Strategische Kompass versucht, diese Hürden zu überwinden – als Vision für eine handlungsfähige, resiliente Union.
Der Text analysiert nicht nur militärische und geopolitische Aspekte, sondern rückt auch die dahinterliegenden politischen Narrative und Ideologien in den Fokus. Die Diskussion um Sicherheit und Verteidigung ist zunehmend auch eine über europäische Souveränität, Solidarität und Werteorientierung. Was bedeutet strategische Autonomie in einer globalisierten Welt? Und wie kann eine Balance zwischen sicherheitspolitischer Verantwortung und demokratischer Kontrolle gelingen?
In Anbetracht steigender Verteidigungsausgaben und wachsender Unsicherheiten an den EU-Außengrenzen stellt sich zudem die Frage, wie nachhaltige sicherheitspolitische Konzepte aussehen könnten. Die Investitionen in europäische Rüstungskooperationen, gemeinsame Projekte wie den EURODRONE oder den Europäischen Verteidigungsfonds zeigen: Es geht nicht nur um kurzfristige Reaktionen, sondern um langfristige Strukturveränderungen innerhalb der Union.
Auch mit Blick auf die Europawahlen 2024/2025 wird klar: Sicherheitspolitik wird ein zentrales Thema des Wahlkampfes. Parteien und Kandidat:innen müssen Lösungen anbieten – und gleichzeitig die öffentliche Debatte über das richtige Maß an europäischer Verteidigung, Kooperation und Eigenständigkeit weiterführen. Denn strategische Autonomie ist keine rein technische Frage. Sie steht im Zentrum eines größeren Diskurses über das Selbstverständnis der Europäischen Union im 21. Jahrhundert.
Hier geht es zum gesamten Artikel.
Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Projekts Newsroom Europe 2025 und wurde von den Teilnehmenden des Projekts verfasst. Newsroom Europe ist ein Projekt der Europäischen Akademie Berlin.
Mit freundlicher Unterstützung der Europäischen Union durch Projektmittel im Rahmen von CERV – Citizens, Equality, Rights and Values.