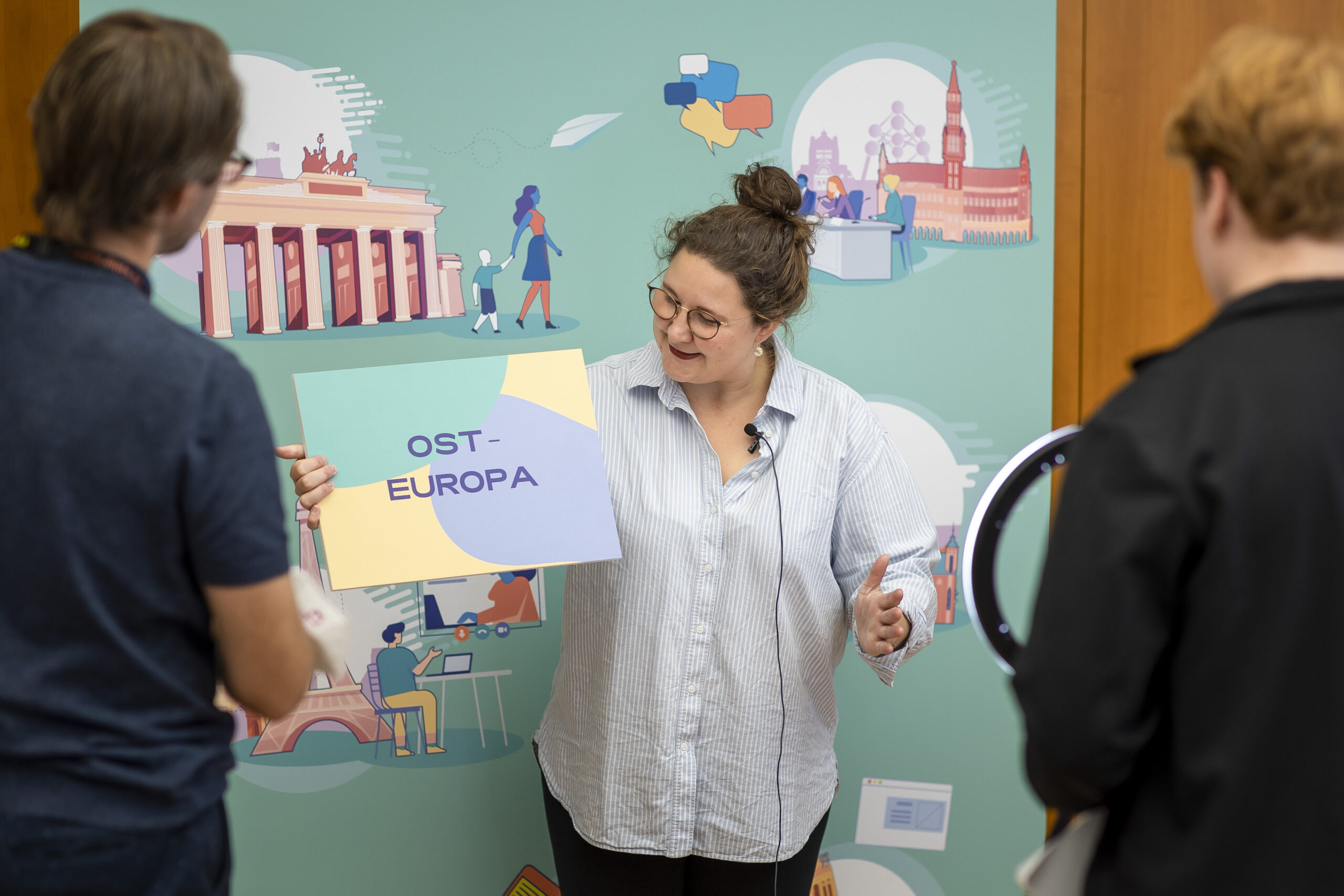Der deutsche Bundestagswahlkampf in europäischer und internationaler Perspektive (Wolfgang Merz)

Dr. Wolfgang Merz analysiert den Bundestagswahlkampf und stellt fest, dass wirtschafts- und finanzpolitische Reformen kaum thematisiert werden. Europäische und internationale Fragen bleiben oft im Hintergrund. Die Ukraine-Unterstützung sowie bessere Beziehungen zu Frankreich und Polen genießen breite Zustimmung. Dennoch fehlt eine klare Strategie, um Deutschlands europapolitische Rolle effektiver zu gestalten.
Der deutsche Bundestagswahlkampf in europäischer und internationaler Perspektive
Dr. Wolfgang Merz
Der Wahlkampf zum neuen deutschen Bundestag rückt in seine entscheidende Phase. Eine neue Regierung wird mit einer Vielzahl von wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforderungen konfrontiert sein. Der bisherige Wahlkampf verdeutlicht allerdings, dass man vor einer solchen Agenda eher zurückschreckt und Vorschläge unterbreitet, die nicht seriös gegenfinanziert sind (massive Steuersenkungen) oder eine deutliche Erhöhung der öffentlichen Verschuldung beinhalten (massive öffentliche Investitionsprogramme).
Im politischen Berlin ist oft vernehmbar, dass Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sei, auf EU-Ebene weiterhin das ökonomisch größte Gewicht habe und auch auf internationaler Bühne in allen wichtigen Gremien hochrangig vertreten sei (abgesehen vom UN-Sicherheitsrat).
Daher stellt sich die Frage: Werden die Parteien diesem Umstand auch gerecht? Ein Blick in die jeweiligen Wahlprogramme soll hierauf Antworten liefern. Diese sind generell sehr breit angelegt und bieten dennoch oft eine Vielzahl an Themen, da auch kleine Fachbereiche sich im Wahlprogramm wieder finden möchten. Ob sich die Bevölkerung damit beschäftigt, bleibt daher fraglich.
Im Folgenden erfolgt nun eine gestraffte Auflistung der wichtigsten Positionen der einzelnen Parteien zu europäischen und internationalen Punkten:
CDU/CSU
Die EU-Wettbewerbsfähigkeit soll durch Binnenmarktvertiefung, weniger Bürokratie und einer Banken- und Kapitalmarktunion vertieft werden. Weitere Handelsabkommen sind anzustreben.
Die europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie soll durch das NATO-Ziel von mindestens zwei Prozent des BIP angeschoben werden. Auch soll Europa mehr kooperieren bei der Beschaffung von Material und Ausrüstung und ein europäischer Raketenabwehrschirm aufgebaut werden.
Ein nationaler Sicherheitsrat soll im Bundeskanzleramt (Vernetzung von Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs-, Handels-, Europa- und Entwicklungspolitik) aufgebaut werden.
Die Beziehungen zu Frankreich und Polen sollen neue Impulse erhalten. Die Ukraine und Israel sollen weiter unterstützt werden.
SPD
Europa soll stark und handlungsfähig sein. Die westlichen Balkanstaaten, auch Ukraine und Moldau, sollen Teil der EU werden unter Einhaltung der Kopenhagener Kriterien. Im Lichte der Erweiterung ist die Einsetzung eines Europäischen Konvents angezeigt, der EU-Reformen vorbereiten soll (u.a.: weg von Einstimmigkeit; Initiativrecht des EP).
Die Verteidigungsfinanzierung von mindestens 2% des BIP sollte nachhaltig erfolgen. Die Ukraine und entsprechende Friedensinitiativen sollten unterstützt werden. Eine europäische Verteidigungsunion mit einer gut aufgestellten Industrie und Rüstungsexportpolitik sollte kreiert werden.
Das Weimarer Dreieck (Deutschland/Frankreich/Polen) gilt es, neu zu beleben. Die Allianzen mit Frankreich und Polen sollen gestärkt werden, dies beinhaltet auch UK.
Bündnis 90/Die Grünen
Die Ukraine gilt es weiterhin auf allen Feldern gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Damit brauchen wir eine starke EU, die gestärkt, erweitert und reformiert werden muss.
Europa muss dabei enger zusammenrücken und gemeinsam für Sicherheit, Wohlstand und Demokratie einstehen, auch um im Wettbewerb mit den USA und China zu bestehen. Die EU soll auch reformiert werden und mehr Eigenmittel erhalten.
Der Ansatz, weltweit auf vielfältige und robuste Partnerschaften zu bauen, in Europa und Amerika, aber auch im Globalen Süden, sollte beibehalten werden.
Die Bündnisverpflichtungen mit einem Verteidigungsetat von dauerhaft mehr als 2% des BIP sollen gewahrt bleiben. Gleichzeitig ist eine starke Diplomatie, ausreichend humanitäre Hilfe und Mittel für Partnerschaften in der Welt nötig. Dies ist nicht alles aus laufenden Einnahmen finanzierbar, sondern erfordert auch eine Erhöhung der öffentlichen Kreditaufnahme.
FDP
Europa sollte handlungsstark und souverän sein. Die EU-Erweiterung soll mit institutionelle Reformen (kleinere Kommission, Initiativrecht des EP, Abkehr von Einstimmigkeit) sowie bei klarer Einhaltung der Kopenhagener Kriterien einhergehen. Verhandlungen mit der Türkei sollten beendet werden.
Die Bürokratie aus Brüssel gilt es zu reduzieren (z.B.: Nachhaltigkeitsberichterstattung; EU-Lieferkettenrichtlinie). Auch das Europäische Einlagensicherungssystem ist kritisch zu sehen. Positiv ist die Entwicklung von Kryptowährungen; bei der Nutzung eines digitalen Euro sollte es keinen Zwang geben. Eine Verschuldungskompetenz auf europäischer Ebene ist abzulehnen. Beim EU-Emissionshandel sollte die Effizienz und nicht eine Überregulierung im Vordergrund stehen.
Die Ukraine gilt es weiter zu unterstützen. Die EU-Verteidigungsindustrie muss gestärkt werden.
In der Außenpolitik soll es mehr Diplomatie statt moralischer Zeigefinger geben und gegenüber Russland mehr Selbstbewusstsein entwickelt werden. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Das Verhältnis zu Frankreich, zu Polen und auch zu UK erfordert neue Impulse. Es gilt, möglichst viele Freihandelsabkommen abzuschließen.
AfD
Bei Europa wird eine Rückkehr zu einer neu zu gründenden europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft mit folgenden Elementen genannt: ein gemeinsamer Markt; Schutz der Außengrenzen; Autonomie in der Sicherheitspolitik; Bewahrung europäischer Identitäten. Gleichzeitig dazu eine Abkehr des „Green Deal“, von einer Euro-Transferunion, dem digitalen Euro sowie der EU-Bürokratie.
In der Ukrainepolitik soll es eine Frieden in Europa und einen Dialog statt Eskalation geben
BSW
Im internationalen Bereich werden für die Ukraine Friedensverhandlungen statt mehr Waffen gefordert sowie eine Ablehnung der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen. Im EU-Bereich wird ein Stopp der Erweiterung verlangt.
Einschätzung
Insgesamt sind europäische und internationale Themen unterbelichtet, und erscheinen dann oft auch ganz hinten. Es werden dabei viele Punkte genannt, ohne darzulegen, wie man die damit verbundenen Ziele auch erreichen kann.
Im Europabereich plädiert die Mehrzahl für ein starkes und handlungsfähiges Europa (Integrationsschritte in einzelnen Bereichen), allerdings mit weniger Bürokratie. Demgegenüber erwähnt die BSW Europa kaum und die AfD schlägt eine Auflösung der EU in ihrer jetzigen Form vor. Erstaunlich dabei ist, dass die demokratische Mitte diesen AfD-Ansatz im Wahlkampf nicht entschiedener mit verschiedenen Argumenten pro Europa entkräftet und satt dessen umgekehrt oft auf die EU-Bürokratie abhebt.
Bei EU-Erweiterung sind alle Facetten vertreten: Zügige Aufnahme mit einer Bandbreite an Bedingungen (von einfacher Aufnahme so bis zur Einforderung von Reformen in der EU) oder einem Aufnahmestopp, in einem Fall nur mit der Türkei.
Im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ist die Mehrzahl auch für größere finanzielle Anstrengungen in diesem Bereich und für den Aufbau europäischer Verteidigungsstrukturen.
Im außenpolitischen Bereich gibt es auch weitgehenden Konsens, die Ukraine weiter zu unterstützen und die doch eingetrübten Beziehungen zu Frankreich und Polen zu verbessern, um damit auch dem Weimarer Dreieck neue Impulse zu verleihen. Das gleiche gilt auch für UK.
Fazit: Die Parteien werden damit den von Deutschland selbst gesteckten Anspruch, ein wichtiger Akteur in Europa und in der Welt zu sein, nur ansatzweise gerecht. Wie es auch anders geht, zeigte der damalige SPD-Chef Schulz, dem es gelang, in den ersten Seiten des damaligen Koalitionsvertrags entscheidende Passagen zur Verankerung der deutschen Politik in Europa hinein zu verhandeln. Hierunter fällt auch, dass kaum thematisiert wird, wie wenig effizient die deutsche Europakoordinierung aus verschiedenen Gründen in den letzten Jahren in Brüssel ablaufen ist. Dies hatte nicht nur eine Enthaltung von Deutschland zur Folge, sondern auch Weisungen, die man so einfach kaum vortragen kann. Hier rasch Abhilfe zu schaffen, wäre sicherlich auch ein Gebot der Stunde.
//
Der Autor Dr. Wolfgang Merz ist Berater, Dozent und Autor mit umfassender Erfahrung in nationalen, europäischen und internationalen Prozessen. Als ehemaliger leitender Mitarbeiter im Bundesministerium der Finanzen und Economist beim Internationalen Währungsfonds bietet er strategische Beratung, praxisnahe Bildung und fundierte Publikationen an. Sein Fokus liegt auf der Verbindung von Ökonomie und Politik, um Organisationen und Individuen in einer vernetzten Welt zu unterstützen.
Mehr unter www.wolfgang-merz.de. | contact@wolfgang-merz.de
//
Die Rubrik EAB Impulse bietet Meinungen und Analysen zu aktuellen Entwicklungen in Europa. Die Beiträge spiegeln allein die Perspektiven der Autorinnen und Autoren wider und laden zum Nachdenken und Diskutieren ein. Weitere Informationen zur Arbeit der Europäischen Akademie Berlin und zu ihren Angeboten finden Sie unter:
Homepage: www.eab-berlin.eu | Newsletter: www.eab-berlin.eu/newsletter