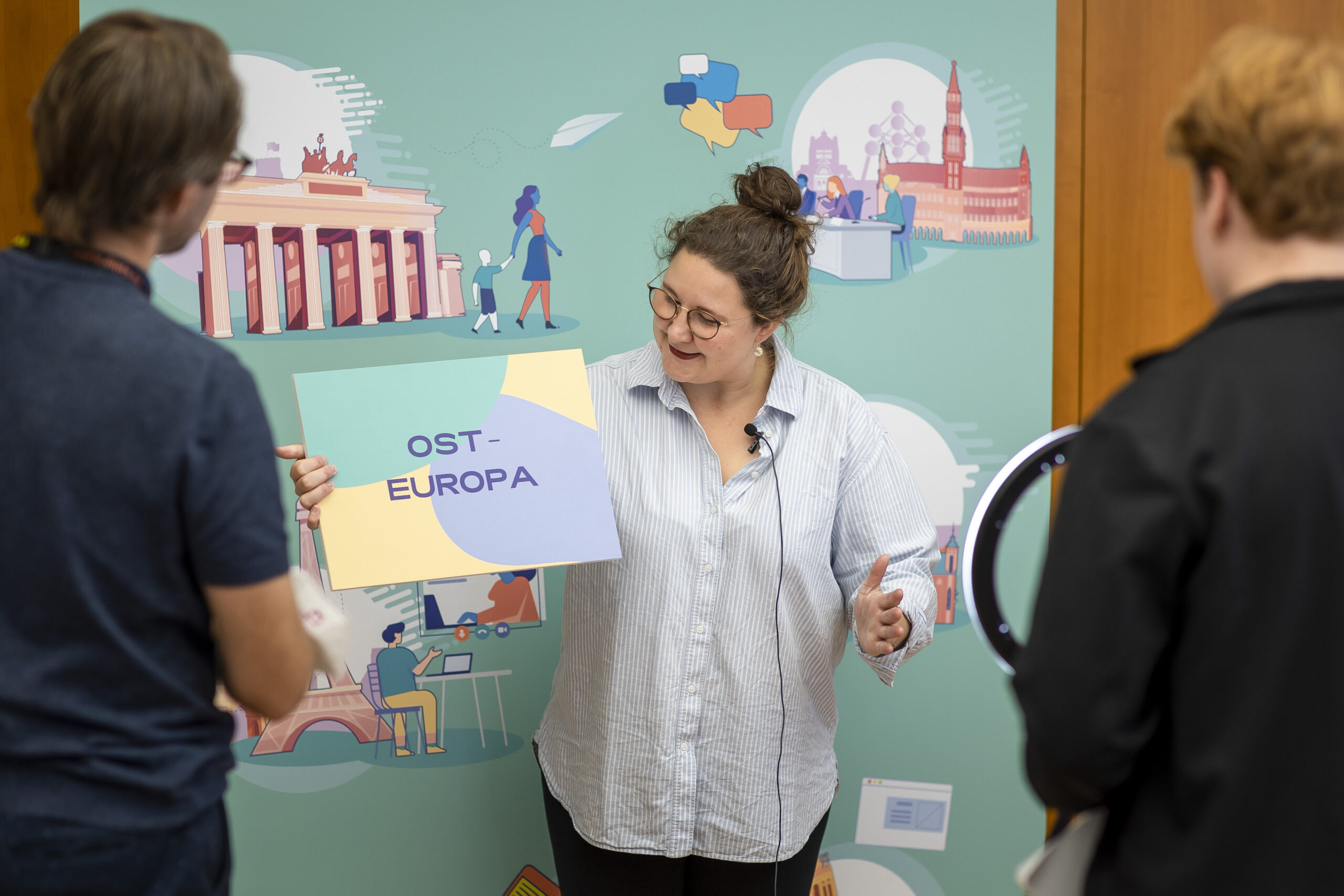Das Finanzpaket der künftigen Bundesregierung in europäischer Perspektive (Dr. Wolfgang Merz)

Das Finanzpaket signalisiert Europas Aufbruch, doch es steht auf wackligem Fundament. Schulden, geopolitische Risiken und schwaches Wachstum bedrohen die Stabilität. Entscheidend wird sein, ob Deutschland wirtschaftlich vorangeht und Europa zusammenhält.
Mit der am 10. April 2025 geschlossenen Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und SPD kündigt sich nicht nur innenpolitisch ein Paradigmenwechsel an. Auch auf europäischer Ebene könnte das angekündigte Finanzpaket eine Zäsur markieren – mit deutlichen Chancen, aber auch gewichtigen Risiken für die Stabilität der Eurozone.
Das Finanzpaket der künftigen Bundesregierung in europäischer Perspektive
Dr. Wolfgang Merz
Ein großer Aufschlag – mit europapolitischer Bedeutung
Im Zentrum der neuen Finanzarchitektur stehen zwei kreditfinanzierte Sonderfonds in Höhe von jeweils bis zu 500 Milliarden Euro – einer für die öffentliche Infrastruktur, der andere für Verteidigungsausgaben. In einem geopolitisch herausfordernden Umfeld ist das eine Dimension, die in Brüssel aufmerksam registriert wird.
Erstens wird damit deutlich: Deutschland ist bereit, nicht nur politisch, sondern auch finanziell wieder als Impulsgeber innerhalb der EU zu agieren. Der oft beklagte europapolitische Rückzug der letzten Jahre scheint damit beendet – zumindest symbolisch. Dass zentrale europapolitische Ressorts nun in einer Hand mit dem Kanzleramt liegen, könnte zudem die innerdeutsche Europakoordination erleichtern.
Zweitens sendet das Paket ein Signal der Handlungsfähigkeit. Die Nutzung nationaler Sonderfonds erhöht Deutschlands Flexibilität, sich an europäischen Finanzierungsinstrumenten – insbesondere im Bereich Verteidigung – künftig aktiver zu beteiligen. Das stärkt auch die Position Deutschlands bei der notwendigen Debatte um EU-eigene Sonderhaushalte.
Belastung für die Eurozone?
So wichtig der finanzpolitische Aufbruch ist – seine Nebenwirkungen für die Finanzstabilität in der Eurozone sind nicht zu unterschätzen. Ein Anstieg der deutschen Schuldenquote ist unausweichlich. Damit stellt sich nicht nur die Frage nach der Vereinbarkeit mit den neuen EU-Fiskalregeln, sondern auch nach möglichen Verwerfungen an den Kapitalmärkten.
Schon jetzt steigen die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen – mit Folgen für Zinsausgaben und Finanzierungskosten im gesamten Euroraum. Das deutsche AAA-Rating steht nicht akut zur Disposition, doch wird seine Zukunft weniger selbstverständlich sein als in der Vergangenheit. Entlastend wirkt immerhin, dass sich die zusätzlichen Schulden auf einen langen Zeitraum verteilen.
Vier strukturelle Faktoren werden maßgeblich dafür sein, ob das Finanzpaket zur Stabilisierung oder Destabilisierung beiträgt:
1. Fehlende Vorbilder: Deutschlands Rolle im europäischen Fiskalrahmen
Der Erfolg des neuen EU-Fiskalrahmens hängt entscheidend von der Glaubwürdigkeit seiner Umsetzung ab. Dass ausgerechnet Deutschland bislang keinen eigenen strukturellen Fiskalplan vorgelegt hat, schwächt die Vorbildfunktion der größten Volkswirtschaft der Eurozone. Für hochverschuldete Länder wie Italien und Frankreich sind ambitionierte Reduktionsziele ohnehin nur schwer realistisch – auch, weil die EU-Regeln weiterhin keine scharfen Durchsetzungsmechanismen vorsehen.
2. Wachstum als Stabilitätsanker: Die Unwägbarkeiten des Koalitionsvertrags
Eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik in Deutschland könnte die finanziellen Risiken deutlich abfedern. Der Koalitionsvertrag zeigt hier Licht und Schatten: Positiv ist, dass zentrale Wachstumshemmnisse wie Infrastrukturmängel, hohe Energiekosten und steuerliche Belastungen angesprochen werden. Doch viele Reformvorhaben bleiben vage oder werden in Kommissionen ausgelagert. Die Chance, den öffentlichen Haushalt grundlegend zu konsolidieren, wurde verpasst. Stattdessen dominieren zusätzliche Ausgabenvorhaben – teils mit klarem Klientelbezug – und alles steht unter Finanzierungsvorbehalt. Das birgt politische Sprengkraft.
3. Globale Unsicherheiten: Die neue Fragilität des Welthandels
Eine intakte globale Handelsordnung bleibt zentrale Voraussetzung für makroökonomische Stabilität in Europa. Die protektionistische Politik der USA unter Präsident Trump hat dem Welthandel bereits erheblich geschadet. Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und China verschärft die Lage zusätzlich. Ein Handelszusammenbruch der beiden größten Volkswirtschaften hätte weltweite Kettenreaktionen zur Folge – mit massiven Rückwirkungen auf exportabhängige Länder wie Deutschland.
4. Verschuldungsdynamik weltweit: Das Risiko einer globalen Schuldenkrise
Auch die internationale Schuldenlage ist besorgniserregend. Die US-Verschuldung steigt ungebremst. Viele afrikanische Staaten sind zunehmend bei China verschuldet, während auf EU-Ebene keine Trendwende in Sicht ist. Hinzu kommt die Finanzierung der russischen Kriegswirtschaft durch Defizite. Das Risiko einer globalen Schuldenkrise ist real und wächst.
Fazit: Mutiger Aufbruch, fragile Basis
Das Finanzpaket der neuen Bundesregierung ist ambitioniert und sendet ein starkes Signal der europäischen Re-Positionierung Deutschlands. Es bietet Chancen für eine stärkere wirtschafts- und sicherheitspolitische Integration der EU und könnte langfristig ein neues Kapitel europäischer Solidarität aufschlagen.
Doch auf dem Weg dorthin sind erhebliche finanzpolitische und geopolitische Risiken zu bewältigen. Die langfristige Tragfähigkeit wird davon abhängen, ob Deutschland wirtschaftlich wieder an Dynamik gewinnt, ob die EU ihre Fiskalregeln glaubwürdig umsetzt – und ob die Weltwirtschaft nicht durch protektionistische Eskalationen oder eine Schuldenkrise destabilisiert wird.
Für Europa liegt darin nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance: In einer Welt wachsender Unberechenbarkeit könnte es mit fiskalischer Solidität und politischer Berechenbarkeit an Vertrauen gewinnen – gerade dann, wenn die USA an internationalem Einfluss verlieren und der chinesische Renminbi nicht zur echten Leitwährung avanciert.
//
Der Autor Dr. Wolfgang Merz ist Berater, Dozent und Autor mit umfassender Erfahrung in nationalen, europäischen und internationalen Prozessen. Als ehemaliger leitender Mitarbeiter im Bundesministerium der Finanzen und Economist beim Internationalen Währungsfonds bietet er strategische Beratung, praxisnahe Bildung und fundierte Publikationen an. Sein Fokus liegt auf der Verbindung von Ökonomie und Politik, um Organisationen und Individuen in einer vernetzten Welt zu unterstützen. Mehr unter: www.wolfgang-merz.de
//
Die Rubrik EAB Impulse bietet Meinungen und Analysen zu aktuellen Entwicklungen in Europa. Die Beiträge spiegeln allein die Perspektiven der Autorinnen und Autoren wider und laden zum Nachdenken und Diskutieren ein. Weitere Informationen zur Arbeit der Europäischen Akademie Berlin und zu ihren Angeboten finden Sie unter:
Homepage: www.eab-berlin.eu | Newsletter: www.eab-berlin.eu/newsletter
Herunterladen